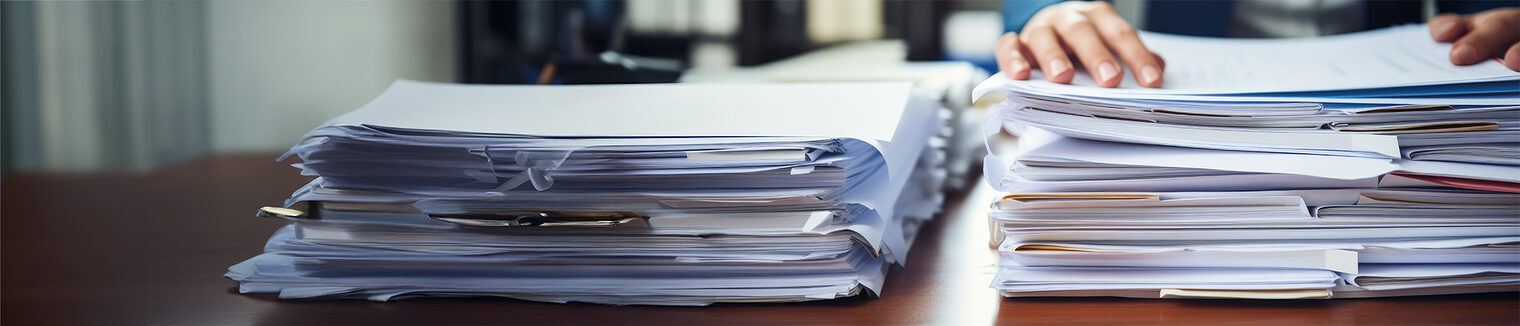Archivbeitrag | Newsletter 2023Was ändert sich 2024?
Vorschriften, Grenzwerte und Verordnungen – mit dem nahenden Jahreswechsel stehen für kleine Start-ups und etablierte Unternehmen im Handwerk wieder eine Reihe an gesetzlichen Änderungen an. Diese können mitunter Einfluss auf Unternehmensstrategie und -führung haben. Damit Sie Ihr Unternehmen erfolgreich und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben navigieren können, haben wir eine Übersicht relevanter Anpassungen und Neuregelungen zusammengestellt. Außerdem sind einige Themen ergänzt, die auch Arbeitnehmer, Steuerzahler, Autofahrer und Immobilienbesitzer betreffen.
Bitte beachten Sie, dass die Auflistung nicht vollumfänglich ist und dass manche Gesetze, steuerliche Entlastungen oder Förderprogramme für Unternehmen und Bürger als Folge des Haushalts-Urteils des Bundesverfassungsgerichts noch in der Schwebe sind. Man sollte die Berichterstattung also im Auge behalten.